
Orte des Widerspruchs? Gedenkstättenarbeit und Erinnerungskultur angesichts gegenwärtiger Herausforderungen
Samstag, 11. Juni 2022, 09.00 - 17.30 Uhr
Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek
Wall 47/51, 24103 Kiel
Gedenkstätten und Erinnerungskultur stehen aktuell vor großen Herausforderungen, wenn nicht sogar vor einer tiefgreifenden Zäsur. Durch sie wird sowohl ihr Selbstverständnis als auch ihre programmatische Ausrichtung in Frage gestellt. Erleben wir gerade das Ende einer Erfolgsgeschichte des historischen Erinnerns an Völkermord und Vernichtungskrieg? Wie unter diesen Umständen umgehen mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, mit der Infragestellung des erinnerungskulturellen Grundkonsenses durch politisch rechte Gruppierungen und mit der scheinbar unaufhaltsamen Instrumentalisierung von Geschichtsbildern?
In Deutschland hat es lange gebraucht, bis sich Staat und Gesellschaft der Verantwortung für die Massenverbrechen während des Nationalsozialismus gestellt haben. Was dann jedoch in den letzten drei Jahrzehnten erinnerungskulturell und gedenkpolitisch geschehen ist, ist in der Tat höchst beachtlich. Dennoch muss das Ergebnis aufgrund der gravierenden politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Veränderungen kritisch diskutiert werden.
Das umfasst vor allem eine Debatte über Einfluss, Rolle und Selbstverständnis staatlicher Akteure in der Gedenkstättenarbeit. Mittlerweile gehört das institutionalisierte Erinnern an die Opfer der NS-Herrschaft zur deutschen Staatsräson, mit der Folge, dass u.a. die Art und Weise sowie die Ziele dieser Arbeit vielfach der staatlichen Regie unterworfen sind. Staat und Parteien steuern nicht zuletzt wegen der finanziellen Zuschüsse in erheblichem Maße das Gedenken an die nationalsozialistische Vernichtungspolitik. Diese Entwicklung hat Konsequenzen: Da das Holocaust-Gedenken heute zum elementaren Selbstverständnis der Bundesrepublik gehört, wird "Erinnern" generell als staatstragender, geradezu positiver Wert herausgestellt und konformes geschichtspolitisches Engagement gefördert. Nach dieser Logik kann die Einübung erwünschter Gedenkforme(l)n bildungspolitisch gar nicht früh genug beginnen.
Da am Holocaust-Gedenken nun offenbar nicht weniger als die Verteidigung unserer Demokratie hängt, scheint eine grundsätzlich kritische Auseinandersetzung über dessen Sinn, Form und Inhalt kaum noch nötig (und manchmal auch nicht erwünscht) zu sein. Jegliches Reden über Vergangenheit, vor allem über die des „Dritten Reiches“, wird bereits als moralisch wertvolles Erinnern missverstanden.
Aus diesen Gründen will die Tagung einen kontroversen Dialog über Konzeption, Praxis und Bildungsziele der gegenwärtigen Gedenkstättenarbeit initiieren, auch angesichts der Herausforderungen durch den aktuellen Krieg in Europa. Es soll nachgedacht und kritisiert, sichere Wahrheiten infrage gestellt und zudem darüber gestritten werden, inwiefern die Gedenkstättenarbeit, wie sie sich seit etwa drei Jahrzehnten entwickelt hat, tatsächlich noch sinnvoll ist.
Veranstaltet wird die Tagung von Ulrike Jureit (Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur), Stephan Linck (Evangelische Akademie der Nordkirche), Karl Heinrich Pohl (Universität Kiel) in Kooperation mit der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek und dem Landesbeauftragten
für politische Bildung. Gefördert wird die Tagung von der Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten und der Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein.

Wessen Erinnerung? Zwischen Konkurrenz und Anerkennung - Erinnerungskultur in der postmigrantischen Gesellschaft
Eine vielfältige Gesellschaft stellt die Erinnerungskultur in Deutschland vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig machen rechtsextreme Akte

Muslimisch jüdisches Abendbrot – Das Miteinander in Zeiten der Polarisierung
Unterschiedlicher könnten sie nicht sein: Saba-Nur Cheemas Familie kommt aus Pakistan, sie selbst ist in einem Frankfurter Brennpunktviertel

Desinformation und Hass gegen Frauen...
Der Deutsche Frauenring Lübeck bietet in Kooperation mit dem Landesbeauftragten für politische Bildung diese Reihe an.
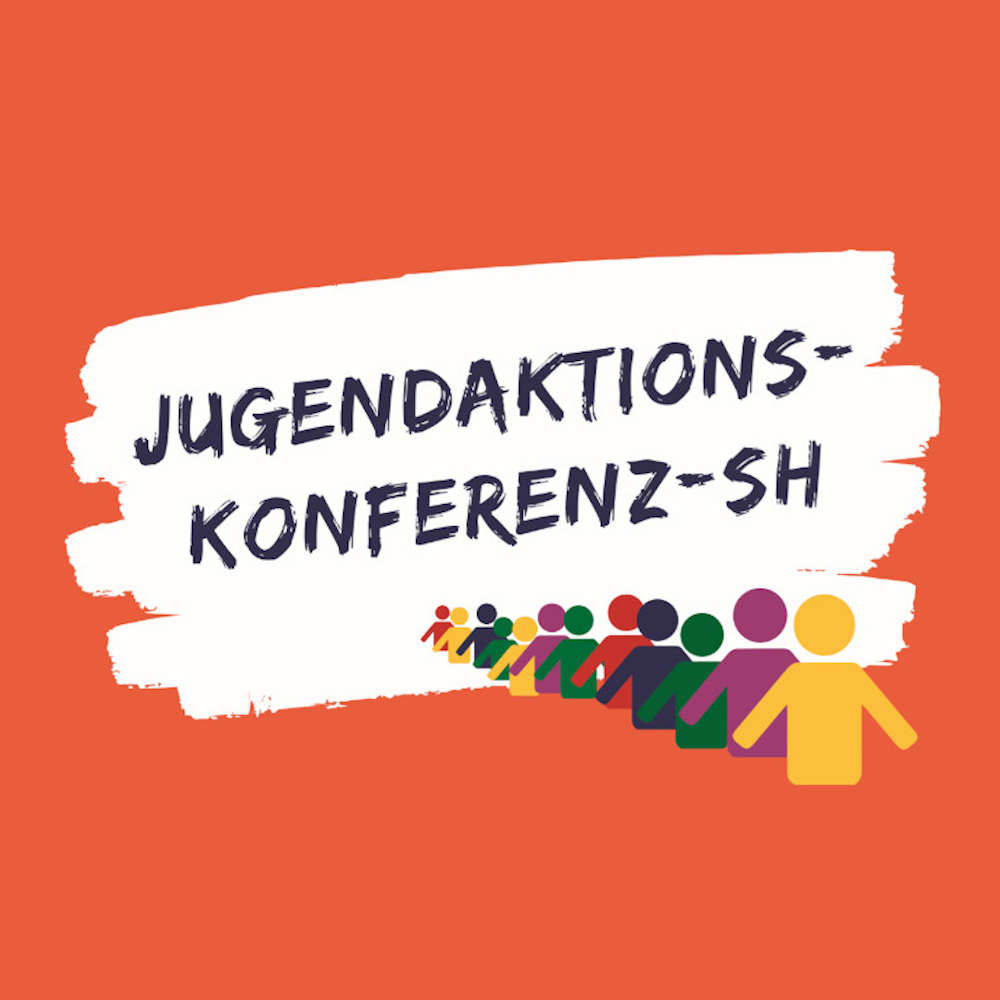
6. Jugendaktionskonferenz-SH
Du bist jung und engagiert? Du hast Lust, in Schleswig-Holstein etwas zu verändern? Dann komm am 2. Juni 2025 zur 6. Jugendaktionskonferenz

Wahlkampf und Verschwörungserzählungen
Wahlen sind das heiligste aller demokratischen Rituale. Verschwörungserzählungen wollen dieses beeinflussen.